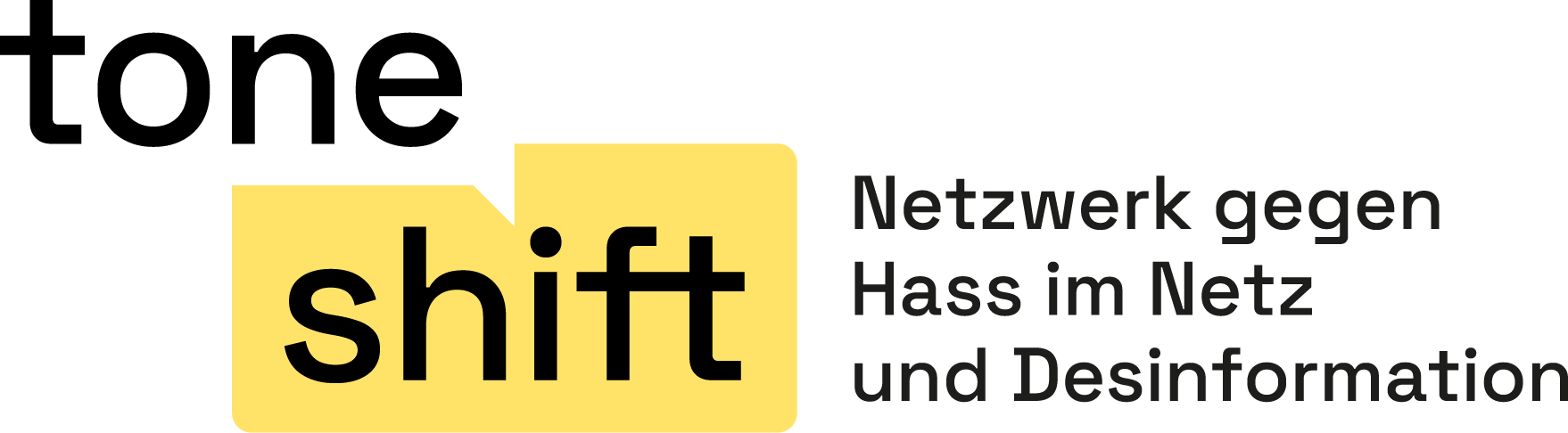Magdeburg, 23.-24. September 2025 ||
Was bedeutet es in einer Zeit von KI und Big Tech, anhaltendem Rechtsruck und extremistischer Radikalisierung, Anfeindungen und Falschinformationen im Internet, wirklich sozial zu handeln? Mehr denn je steht politische Medienbildung vor der Herausforderung, Desinformation und digitaler Hetze etwas entgegenzusetzen. Eines der Ziele kann sein, das „Soziale“ wieder zurück in die sozialen Netzwerke zu holen. Fragen wie die folgenden können unseren Austausch leiten: Welchen neuen Entwicklungen sehen wir uns im Feld gegenüber? Welche strukturellen und konzeptionellen Lücken bestehen in der Landschaft von Medienpädagogik und politischer Bildung zu den Themen Hass im Netz und Desinformation und wie können beide Bildungsbereiche noch besser zusammenarbeiten? Wie bearbeiten Akteur*innen im Feld diese Problemlagen und was können wir voneinander lernen?
Ausgehend von diesen Fragen lädt das Team der GMK in toneshift – Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation alle im Themen- und Praxisfeld tätigen Expert*innen zu einer 2-tägigen Fachveranstaltung ein, um mögliche Antworten vorzustellen, zu diskutieren, sich enger zu vernetzen und gemeinsame Strategien zu entwickeln. Freut euch auf Inputs zu aktuellen Entwicklungen im Themenfeld, Workshops pädagogischer Fachkräfte und interaktive Austauschformate.